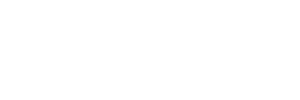Ansprache des Bundeskanzlers zum Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen
Nachrichten
Videojournal
Maßnahmen
Informationsarbeit
BiZ-Seminare
Kreativgruppen
Fundraising
Kulturarbeit
Spracharbeit
Jugendarbeit
Eliteförderung
Sozialarbeit
Selbstorganisation
Internationale Zusammenarbeit
Wirtschaft
Rehabilitation
Monitoring
Verlaufsmonitoring
Videoprojekt „Wir kochen deutsch“
Filme
Mobile Apps

Ansprache zum Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen am 28. März 2023
Bundeskanzler Olaf Scholz MdB
Sehr geehrter Herr Dr. Fabritius,
verehrte Mitglieder der Landsmannschaften und Landesverbände,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten,
Exzellenzen,
meine Damen und Herren,
wir haben in Europa die Hoffnung gehabt, dass die Freiheit und die Demokratie sowie die Unverletzbarkeit der Grenzen dazu beitragen, dass wir ein freies Europa erleben, in dem wir die schlimmen Erfahrungen des letzten Weltkrieges und der Zerstörung, die er mit sich gebracht hat, die unglaublichen Folgen, die er durch den unglaublichen Mord an den europäischen Juden, aber eben auch das Schicksal der Vertreibung mit sich gebracht hat, hinter uns gelassen haben, indem wir dazu beigetragen haben, dass eine friedliche Perspektive möglich wird. Klar, was die europäischen Juden betrifft, wissen wir, dass unsere Verantwortung für dieses Verbrechen immer währt und wir alles dazu beitragen müssen, dass wir dieser Verantwortung auch in Zukunft gerecht werden, indem wir alles dafür tun, dass jüdisches Leben in Deutschland wieder entstehen kann, und alles dazu beitragen, dass wir jedem Antisemitismus entgegentreten.
Aber das ist auch die Wahrheit: Mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sind revanchistische, imperialistische Aktivitäten, ein furchtbarer Krieg, wieder Realität in Europa geworden. Putin will die Identität der Ukraine auslöschen. Er will sie durch die Idee eines großrussischen Reichs ersetzen. Dafür überzieht er die Ukraine mit Leid und Zerstörung und gefährdet auch die Zukunft seines eigenen Landes.
Zugleich missachtet Russland die Grundsätze unserer europäischen Nachkriegsordnung, allen voran den Grundsatz, dass Grenzen nicht mehr mit Gewalt verschoben werden dürfen. Es war doch die eigentliche Konsequenz und das eigentliche Ergebnis der Entspannungspolitik der 70er-Jahre, dass wir uns in KSZE und OSZE darauf verständigt haben, dass eine solche gewaltsame Verschiebung von Grenzen nicht mehr stattfindet. Wir haben uns lange genug vor all denjenigen gefürchtet, die in Geschichtsbüchern geblättert haben, nachgeschaut haben, wo Grenzen früher einmal verlaufen sind, um dann daraus kriegerische Ambitionen für sich abzuleiten und furchtbare Zerstörung anzurichten, und wir wissen ganz genau, wohin das führt, wenn gewissermaßen jemand in den Atlanten der Vergangenheit guckt, wo man Grenzen schon einmal gezogen hat.
Ich habe gerade ein Gespräch mit dem kenianischen Präsidenten geführt ‑das will ich hier nicht unerwähnt lassen‑, dessen Botschafter im Weltsicherheitsrat etwas sehr Bemerkenswertes gesagt hat: Wisst ihr eigentlich, wie die Grenzen in Afrika entstanden sind? Da haben betrunkene Kolonialherren irgendwelche Grenzen gezogen, durch Landschaften, durch Gebiete, durch Völkerschaften, Königreiche, was auch immer dort jeweils existiert hat, und Menschen in einem Land vereint, die noch nie voneinander gehört hatten, aber auch Menschen auseinandergeteilt, die eng miteinander verbunden waren. Wenn wir in Afrika, hat er damals gesagt, daraus jetzt Konsequenzen ableiten würden und Grenzen wieder neu verschieben würden, wo sollte das enden?
Wo soll das enden? Das ist doch die Frage, die wir uns tatsächlich stellen müssen, wenn wir sehen, was jetzt passiert. Es ist erschütternd, mitzuerleben, dass hier in Europa im 21. Jahrhundert wieder ein solcher Krieg stattfindet. Denn Krieg und Vertreibung bleiben Geißeln der Menschheit. Sie haben sie in Ihrem Jahresempfang zu Recht betitelt.
Wir alle wollen, dass diese Geißeln verschwinden. Wir wollen, dass dieser Krieg endet, so schnell wie möglich. Dafür reicht es aber nicht, pauschal nach Friedensverhandlungen zu rufen, wie es einige tun. Ja, es muss Friedensgespräche geben; das ist ganz offensichtlich. Aber mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln außer über die eigene Kapitulation. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir sehr klar benennen, was die Voraussetzung für den Frieden ist, nämlich dass Putin erkennt: Er wird seine Ziele nicht erreichen. Sein Imperialismus wird nicht siegen.
Deshalb unterstützen wir die Ukraine solange, wie es nötig ist. Deshalb liefern wir Waffen. Deshalb bilden wir ukrainische Soldaten hier in Deutschland aus. Es geht darum, das Recht gegen das Unrecht zu verteidigen, und es geht darum, den Angegriffenen zur Seite zu stehen. Die schrecklichen Fotos und Filmaufnahmen aus Butscha und Mariupol, aus Mykolajiw und Bachmut, haben sich tief in unser Gedächtnis eingebrannt‑ Bilder von ermordeten Zivilisten, von zerbombten Häusern und Städten, von matschigen Schützengräben, vom erbitterten Kampf sich gegenüberstehender Panzer und Artilleriegeschütze.
So rollen seit gut einem Jahr auch wieder Züge gen Westen – allerdings nicht, weil sich Grenzen geöffnet haben wie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Es sind Züge, die vor allem Frauen, Kinder und Ältere in Sicherheit bringen vor russischen Bomben, vor Hunger, Not und der Gefahr für Leib und Leben.
14 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer wurden seit Beginn des russischen Angriffskriegs aus ihrer Heimat vertrieben oder mussten fliehen – rund acht Millionen davon in die der Europäischen Union. Jede und jeder Einzelne von ihnen lässt die eigene Heimat zurück, das Haus, die Arbeit oder die Schule, die Freunde, die Familienangehörigen.
Über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind auch zu uns nach Deutschland gekommen. Wir heißen sie hier willkommen. Das ist nicht nur unsere völkerrechtliche Pflicht. Das gebietet die Menschlichkeit. Deshalb bin ich unendlich dankbar für die große Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, die Mitgefühl zeigen, die mit anpacken und die dafür sorgen, dass die ukrainischen Flüchtlinge hier gut ankommen.
Auch Sie, sehr geehrter Herr Dr. Fabritius, und der Bund der Vertriebenen haben sich über alle Maßen engagiert – zum Beispiel durch Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer vor Ort in den Beratungsstellen oder online. Sie haben Hilfe für Flüchtlinge in der Ukraine organisiert ‑ wir haben es eben gerade wieder gesehen. Auch über die Landsmannschaften haben Sie Spenden- und Hilfsaktionen ins Leben gerufen‑ in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten in der Ukraine, Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien.
In der Krise hat sich wieder einmal gezeigt, wie gut und eng die Verbindungen der deutschen Minderheiten in die osteuropäischen Staaten sind ‑ sie sind wahre Brückenbauer. Auch der Bund der Vertriebenen hat dabei tatkräftig geholfen. Dafür sage ich Ihnen von ganzem Herzen: Vielen Dank!
Ihr Einsatz ‑ davon bin ich sehr überzeugt ‑ hat auch etwas mit Empathie zu tun, mit der Fähigkeit, sich in die Not anderer hineinzuversetzen.
Als in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs und in den Jahren nach 1945 zwölf Millionen Pommern, Schlesier und Ostpreußen aus der Batschka oder vom Schwarzen Meer vertrieben wurden, da war die Not groß. Abschied und Neuanfang schmerzten. Obwohl sie Landsleute waren, galten die Neuankömmlinge vielen im Westen als Fremde. In der DDR waren die Heimatvertriebenen sogar damit konfrontiert, dass ihre Selbstorganisation verboten war. Schon die Erinnerung an die Vertreibung konnte so nur im privaten Umfeld erfolgen. Einige von Ihnen hier im Raum werden sich daran noch erinnern. Einige wissen es aus den Erzählungen der Eltern oder Großeltern.
Umso berührender ist es zu erleben, dass das Erbe der Heimatvertriebenen und auch ihre Erfahrung von Flucht und Neuanfang unser Land bis heute prägen. Die Frauen und Männer, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten, ihre Kinder und Enkel haben nicht nur unser Land zupackend mit aufgebaut. Aus der Erfahrung, bei null anfangen zu müssen, haben sie Empathie entwickelt, die auch andere mitnimmt.
Die Vertriebenen, aber eben auch ein Verband wie der BdV haben die richtigen Schlüsse aus der Geschichte gezogen, indem sie eben nicht im ständigen Rückblick einer vermeintlich guten alten Zeit nachtrauern, sondern dabei mithelfen, dass unsere Gegenwart und Zukunft geprägt sind von mehr Menschlichkeit, Mitgefühl und Versöhnung.
Deshalb ist es gut für unser Land, wenn die Kinder- und Enkelgenerationen am Schicksal der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler Anteil nehmen. Viele gehen auf Spurensuche nach den Wurzeln ihrer Familien, entschlüsseln ihre Geschichte und reisen an die Orte ihrer Herkunft. Besuche ehemaliger Heimatvertriebener oder ihrer Angehörigen gehören in Polen oder Tschechien längst zum Alltag und sind dort sehr willkommen. Zum Teil haben sich daraus auch enge Kontakte oder Hilfs- und Unterstützungsprojekte entwickelt. Auch das ist Teil der Aussöhnung in Europa.
Dafür stand schon im Jahr 1950 die wegweisende Charta der Heimatvertriebenen, in der es heißt:
„Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können.“
Und dafür steht Ihre Versöhnungsarbeit in Europa bis heute und in Zukunft.
Deshalb möchte ich mich hier ganz ausdrücklich zur Unterstützung des Bundes der Vertriebenen und seiner Versöhnungsarbeit bekennen. Dazu zählt, die Kultur und die Geschichte der Deutschen aus den ehemaligen Siedlungsgebieten im östlichen Europa lebendig zu halten.
Heute haben wir Museen, Bibliotheken und wissenschaftliche Einrichtungen, die dieses kulturelle Erbe erforschen und präsentieren – auch dank der engen Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Das im Jahr 2021 neu eröffnete Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung zeigt, welch großes Interesse daran besteht, übrigens auch international.
Schließlich haben wir im vergangenen November eine Lücke geschlossen, die von vielen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern als große Ungerechtigkeit empfunden wurde. Bei Fällen, bei denen die gesetzliche Rente wegen der Fluchtgeschichte sehr gering ist, helfen wir mit einem neuen Fonds. Sie haben darüber schon gesprochen, dass er natürlich ‑ wie alle Fonds ‑ nicht zureichend ist. Wir hoffen auch noch, dass möglichst viele der deutschen Länder sich entscheiden, bei diesem Fonds einzusteigen. Die Möglichkeit besteht ja.
Aber es ist ein Zeichen, dass wir genau wissen, wie herausfordernd es ist, wenn man nicht die ganze Zeit hier in der Bundesrepublik gelebt hat und seinen eigenen Beitrag für die spätere Rente leisten konnte. Das soll hier eben auch seinen Niederschlag finden.
Die Kriege des 20. Jahrhunderts haben im Leben von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern tiefe Spuren hinterlassen, die auch noch viele Jahrzehnte später zu sehen sind. Da gibt es gar keine Frage.
Die aus dem Banat stammende Schriftstellerin Iris Wolff, die als Kind mit ihrer Familie nach Deutschland kam, hat die Folgen in ihrem Leben einmal so beschrieben:
„Durch den Verlust meiner ersten Heimat gelingt es mir, überall schnell zuhause zu sein, aber ich fühle mich doch auch auf eine gewisse Weise nicht zugehörig. Das war, besonders als Kind, nicht leicht.
Inzwischen kann ich jedoch die Freiheit und die Möglichkeiten sehen, die aus dieser Erfahrung resultieren. Ich hätte nie ein Buch geschrieben, wenn es diese doppelte Verwurzelung nicht gäbe.“
Erste und zweite Heimat, doppelte Verwurzelung ‑ ich denke, viele derjenigen, die heute vor Russlands Krieg fliehen müssen, können nachempfinden, was Iris Wolff da zum Ausdruck bringt. Zugleich werden sie damit zu Kronzeugen dafür, dass Putins Imperialismus ein Irrweg ist, dass seine Vorstellung einer großrussischen Identität und einer möglichst gleichförmigen Gesellschaft nicht ins 21. Jahrhundert gehört.
Und daher kann ich sagen: Ja, auch der Ukraine-Krieg wird tiefe Spuren in Europa hinterlassen und uns auf lange Zeit hin beschäftigen und verändern, doch nicht im Sinne Putins, sondern im Sinne eines Europas, das in Freiheit geeint ist, das seine kulturellen Unterschiede als Bereicherung empfindet – ein Europa, das enger zusammensteht als je zuvor.
Schönen Dank!
31 März 2023
Quelle: www.bund-der-vertriebenen.de